| Die Stadt, die schlecht schläft
VON THORTSEN SCHMITZ
FOTOS: ASHKAN SAHIHI
MAGAZIN DER
SUEDDEUTSCHEN
ZEITUNG
No. 10 / 08-03-02 |

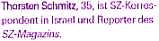
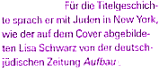 |
ZWEI MILLIONEN JUDEN LIEBTEN IHR NEW YORK, WEIL SIE SICH SICHER
FÜHLTEN. DAMIT IST ES NUN VORBEI.
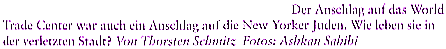
Auf dem Flug von Tel Aviv nach New York sitze ich neben
einem kahl geschorenen Israeli, der soeben die Armee hinter sich gelassen
hat. Er heißt Jonathan, ist 22, hat tätowierte Oberarme und am Poansatz,
sagt er, "flattert ein Schmetterling". In Israel lassen sich junge
Menschen tätowieren als gäbe es die Geschichte nicht. Dabei leben dort
mehr Tätowierte als anderswo. Auch Jonathans Großmutter trägt eine
Tätowierung am linken Unterarm - aus Auschwitz. Als sie die Blüten auf
seinen Armen zum ersten Mal sah, weigerte sie sich, mit ihm zu sprechen.
"Ich will das nicht mehr", sagt Jonathan, "den Holocaust, den Krieg, die
Religion."
Bis vor kurzem noch kontrollierte Jonathan
Palästinenser, die genauso alt waren wie seine Eltern; zwei israelische
Soldaten hat er sterben sehen. "Ich muss die Bilder vergessen", sagt er
und versinkt in Woody Allens Im Bann des Jade-Skorpions auf dem
Videoschirm vor ihm. New York ist das Wohnzimmer Israels, Jonathan will es
sich dort bequem machen. "Muss es ausgerechnet New York sein?", haben ihn
seine Eltern noch unter dem Eindruck des 11.September gefragt. Als Antwort
machte Jonathan eine Gleichung auf: "Ob ich nun in New York von arabischen
Terroristen umgebracht werde oder in Tel Aviv vor einem Club, ist doch
egal."
New York ist die größte jüdische Stadt der Welt. Von den
acht Millionen Einwohnern sind zwei Millionen Juden, sie prägen das
gesellschaftliche und politische Leben. Zwölf Jahre nach Ed Koch hat die
Stadt mit Mike Bloomberg wieder einen jüdischen Bürgermeister, Woody Allen
und Bette Midler leben hier, die Schriftstellerin Susan Sontag, die
Fotografin Annie Leibovitz, die Modedesignerin Donna Karan. Die New York
Times wird von Juden herausgegeben, die größten Taxiunternehmen heißen Tel
Aviv und Jaffa und sind jüdisch; koschere Essenslieferanten bringen
freitags das SchabbatDinner, zum jüdischen Fest Chanukka stehen in allen
Hotels und Bürolobbys siebenarmige Kerzenleuchter auf den Empfangstresen.
„ES KANN
KEINE SICHERHEIT IM LEBEN GEBEN, WENN ES MÖGLICH IST, JUDEN MILLIONENFACH
ZU VERGASEN.“
Wie lebendig die jüdische Gemeinde ist; zeigt unter
anderem die im Februar gegründete Zeitschrift Heeb, die von
zwanzigjährigen Juden herausgegeben wird. Sie ist dem "coolen Juden"
gewidmet, wie der Untertitel "The New Jew Review" andeutet, Steven
Spielberg und der jüdische Unternehmer Charles Bronfman unterstützten das
Blatt mit insgesamt 70000 Dollar.
Die Redaktion des Hochglanzmagazins befindet sich in
Brooklyns Stadtteil Williamsburg, wo orthodoxe Juden Tür an Tür mit
Szenegängern und Hispanics leben. Die Art Directorin des Blattes, Nancy
Schwartzman, sagt: "Es gibt keinen besseren Ort auf dieser Welt für
Heeb als New York. Die Stadt sei toleranter als Jerusalem und reicher
als ganz Israel.
Schwartzman hat jüngst ein Jahr in Israel gelebt und
dort die "hippen" Israelis als Vorbild für das neue New Yorker Magazin
entdeckt. Die erste Ausgabe berichtet über Neil Diamond, die erste
jüdische Skateboardfahrerin, die Skateboarden an hohen Feiertagen wie Jom
Kippur "okay" findet, und über Afrolook-Frisuren von New Yorker Juden. Bei
der Eröffnungsparty in der "Essex Lounge" in Manhattan tanzten jüdische
Go-go-Boys und verteilten das Premierenheft — es ist den Opfern des
11.September gewidmet.
 |
Im Wartezimmer von Ina Anisfeld wird man mit
Talibankämpfern und einem Meeresrauschen allein gelassen. Die Wellen
kommen aus einem Kassettenrecorder, der sich auch auf
Gebirgsbachgeplätscher und Vogelgezwitscher einstellen lässt. Bin
Laden und seine vermummten Helfer prangen auf den Titeln von
Newsweek und Time, andere Zeitschriften gibt es nicht. Als
ich die Assistentin frage, ob ich mir den Gebirgsbach anhören darf,
schürzt sie ihre Lippen zu einem "No". Seit drei Jahren rauscht das
Meer im Wartezimmer von Frau Anisfeld nun schon, im 27. Stockwerk
eines Bürogebäudes in Midtown Manhattan. Und die Patienten von Frau
Anisfeld, sagt ihre Assistentin, schätzten es nicht, wenn Dinge sich
änderten. |
Ina Anisfeld ist Psychologin und verfügt über einen
großen jüdischen Kundenstamm. Sie sitzt in einem Ohrensessel zwischen zwei
Fenstern. Durch das eine sieht man das Empire State Building und die
Flugzeuge, die wieder darüber hinwegfliegen. Durch das andere Fenster hat
man einen Blick auf die Südspitze von Manhattan. Kurz nach dem
11.September hat Ina Anisfeld überlegt, ob sie ihren Sessel in eine andere
Ecke stellen solle. Aber der Blick, haben ihr Patienten gesagt, sei schon
die halbe Therapie.
Viele ihrer Patienten leiden noch immer an
posttraumatischem Stress, schlafen schlecht, kauen Fingernägel, bekommen
Schweißausbrüche, haben Angst vor arabischen Taxifahrern und manchmal
davor, dass sie als Juden für den Angriff verantwortlich gemacht werden
könnten. Ein junger Israeli, der die Erinnerung an seine Zeit in der Armee
auslöschen möchte, hat seit dem 11.September wieder Albträume, fühlt sich
von Terroristen verfolgt. Ein anderer spielt mit dem Gedanken, nach Israel
auszuwandern: Dort würde er sich sicherer fühlen. Ältere Patienten hätten
gepackte Koffer im Flur stehen, einer von ihnen habe eine Liste mit
Telefonnummern angefertigt: Bei einem neuen Angriff soll jeder, der darauf
steht, schnell informiert werden. Der Ausnahmezustand ihrer Patienten sei
kein Verfolgungswahn im herkömmlichen Sinne, sagt Anisfeld. Die Angriffe
hätten schlicht jüdische Urängste hervorgerufen. Damit sie besser mit der
Erfahrung des 11.September umgehen können, sagt sie allen Patienten
denselben Satz: "Es kann keine Sicherheit im Leben geben, wenn es möglich
ist, Juden millionenfach zu vergasen."
Dass bin Laden sich New York als Ziel seines Angriffs
auf Amerika ausgesucht hat, hat nach Meinung von David Gelernter mit den
Juden der Stadt zu tun. Gelernter ist Computerwissenschaftler in Yale und
Opfer eines rechtsextremen US-Terroristen gewesen: Eine Briefbombe
verletzte ihn schwer. "Bin Laden hasst die Juden", schrieb er in einem
Essay im Oktober. Deshalb hätten bin Ladens Terroristen versucht, die
größte jüdische Stadt der Welt "in ein Brandopfer zu verwandeln".
"WIR JUDEN WISSEN, WIE ES IST, VERFOLGT ZU
WERDEN. ABER WIR HABEN NICHT DAS MONOPOL AUFS LEIDEN."
Die meisten Schriftsteller und Künstler empfinden
ähnlich wie der Computerwissenschaftler. Louis Begley etwa, der
Rechtsanwalt, Schriftsteller und Präsident des amerikanischen
PEN-Zentrums, sagt: "Wir Juden in New York sind der große Satan für bin
Laden." Der Autor Tom Segev kann gar nicht genug Parallelen beschreiben
zwischen New York und Israel. Am 10.September war er aus Jerusalem kommend
in New York gelandet, um "ein ruhiges" akademisches halbes Jahr zu
verbringen. Einen Tag später "hatte ich Israel vor der Tür". Vor allem die
Glorifizierung der Feuerwehrmänner erinnere ihn an die Verehrung von
Luftwaffenpiloten in Israel. Und so, wie die Menschen in Amerika nun sich
selbst versicherten: "Wir haben Pearl Harbour überlebt, wir werden bin
Laden überleben", sagten die Menschen in Israel: "Wir haben den Holocaust
überstanden, wir werden auch Jassir Arafat überstehen."
"ICH DACHTE MIR, ES GEHÖRT DAZU, DASS WIR DIE PARTIKEL DER
VERSTORBENEN SEELEN EINATMEN."

Die Autorin Lily Brett möchte
jetzt erst recht in keiner anderen
Stadt leben. |
Lily Brett hat eine Schwäche für
Kleider, und wenn sie mit einem Roman gerade mal nicht weiterkommt,
streift sie durch Chinatown und kauft Stoffe. Anschließend schickt sie
diese per Kurier zu ihrem besten Freund nach Sydney, wo er ihr Kleider
und Blusen daraus schneidert. Als das erste Flugzeug in den Nordturm
flog, diskutierte sie mit ihrem Freund gerade die Tiefe des künftigen
Dekolletees. Lily Brett rannte auf die Wooster-Straße in SoHo, wo die
Nachbarn bereits zu den Türmen hinaufschauten. Lily Bretts Eltern
haben Auschwitz überlebt, in ihren Büchern ist das Dritte Reich
zentrales Thema, und als sie an jenem Dienstagmorgen den Kopf zu, den
Türmen reckte, hatte sie nur diese eine Assoziation: Auschwitz.
"Ich bin mit brennenden Menschen aufgewachsen. Als ich
die Türme in Flammen sah und herabfallende Körper, musste ich sofort
an Auschwitz denken." Drei Tage nach dem Angriff verließ Lily Brett
mit ihrem Freund David Rivkin die Stadt, dann aber siegte das Heimweh
nach SoHo. "Es roch noch immer nach Tod. Aber ich dachte mir, das
gehört dazu, dass wir die Partikel der verstorbenen Seelen einatmen." |
Es gebe einfach keinen anderen Ort auf der Welt, an dem
sie lieber wohnen möchte, gerade jetzt. Lily Brett sitzt vor einem Glas
Kamillentee in einem geblümten Kleid ihres australischen Couturiers,
knabbert an einem Stück Matze und sagt: "Als Jude fühlt man sich in New
York zu Hause. Jeder versteht meinen Vater und seinen schrägen polnischen
Akzent, es gibt Taxifahrer, die Jiddisch sprechen." Und welche aus Beirut,
mit denen streitet Lily Brett über Israel, was wiederum nur in New York
möglich sei: dass eine Jüdin und ein Muslim in einem Taxi miteinander
reden, nicht Krieg führen.
Der Kellner in der Bar des feinen "Carlyle Hotel" schaut
griesgrämig auf meine Turnschuhe, dann auf seine Liste für diesen
Montagabend. Ich sehe nicht aus, als könnte ich mir einen Abend mit Woody
Allen leisten: 150 Dollar kostet allein der Eintritt, zwanzig Dollar ein
Glas Wein. Er führt mich weit weg von der Bühne, an einen Platz irgendwo
zwischen zwei Säulen. Erst als ich ihm sage, ich käme aus Israel, strahlt
der Kellner und erzählt, er habe dort Verwandte. Und einen besseren Platz
für mich.
Immer montags ab halb neun spielt Woody Allen zusammen
mit der New Orleans Jazz Band. Sein Agent hatte mir gesagt, ich sollte
versuchen, ihn nach dem Konzert anzusprechen. Viel Hoffnung aber hatte er
mir nicht gemacht: "Mr. Allen gibt keine Interviews darüber, wie er sich
als Jude fühlt."
An diesem Montag machte Woody Allen keinen glücklichen
Eindruck. Er lächelte kein einziges Mal. Wenn er nicht spielte, legte er
die Klarinette auf seinen Schoß und ließ die Schultern hängen. So als
hätte er die ganze Last der Welt auf seinen Schultern zu tragen.
Der Terroranschlag, hatte Allen in den Tagen nach dem
11.September gesagt, sei "grauenhaft", aber "er wird mein Leben nicht
verändern". Nur drei dieser Montage hatte er ausfallen lassen. Er fühle
sich zwar nicht mehr so sicher wie ehedem, "aber verlassen werde ich New
York nie!" In den Tagen nach dem Anschlag wollte Woodv Allen Blut spenden,
aber seine Blutgruppe 0 war nicht gefragt. So schmierte er Sandwiches für
die Feuerwehrleute.
|
Stanley Cohen wohnt in einer Ecke des East Village, die er
seinen Besuchern nachts nicht zumuten möchte: "Kommen Sie, wenn es hell
ist". Die Hauswände sind mir Graffiti übersprüht, auf den Trottoirs
stehen Drogendealer mit Goldketten und alle paar Minuten rasen
halbwüchsige Puerto-Ricaner mit ihren Wagen die Avenue-D entlang —
ohrenbetäubender HipHop dröhnt durch die offenen Fenster.
|
 |
Um zwölf Uhr mittags klingle ich an Cohens schwerer
Eisentür, er empfängt mich im Bademantel und einer zweiten Warnung: "Von
nun an sind Sie im Visier des FBl". Cohen entschuldigt sich, er müsse eben
noch duschen, ich solle doch fernsehen. Seinen gereizten Hund stellt er
mit Karotten ruhig. Im Flur hängen Bilder aus Cohens Leben: als
Hausbesetzer, als Demonstrant, als Sozialarbeiter mit Drogenabhängigen auf
Entzug, als Freund der Palästinenser: Auf einem Bild steht er neben
Arafat. Stanley Cohen ist eine der derzeit umstrittensten Personen im
öffentlichen Leben der USA: Er verteidigt als Anwalt Muslime, die im
Verdacht stehen, für bin Ladens Al-Qaida zu arbeiten. Und Cohen ist Jude.
Die Juden Amerikas sagen, so einer kann kein Jude sein. Und die Muslime
umarmen ihn. Der palästinensische Hausbesitzer schätzt die Arbeit des
Juden für Muslime so sehr, dass er von Cohen nur wenig Miete für
das Loft verlangt. Deshalb bleibt Cohen der Avenue D treu.
Als er mit nassen Haaren aus dem Badezimmer kommt,
klingelt das Telefon. Es ist CNN, zum dritten Mal in dieser Woche. Dass
Cohen als Jude Muslime und Terroristen verteidigt, sprengt
Vorstellungskraft und Toleranz. Er spricht Arabisch, betritt Moscheen in
Brooklyn mit einem "As-salam alaikum" und er ist eng befreundet mir Moussa Marzook,
dem politischen Führer der radikal-islamischen Hamas, der seit 1997 im
syrischen Exil lebt. Cohen verteidigt in diesen Tagen sich — weil er selbst
Menschen verteidigt, die seiner Ansicht nach für eine "gerechte Sache"
kämpfen. Er sieht sich als Scharnier zwischen der Welt der Juden und jener
der Muslime: "Wir sind alle Semiten."
Wenn Cohen redet, dann nicht, um zu argumentieren,
sondern um zu überzeugen: Es sei doch eigentlich unmöglich, dass "ein Jude
ein Hamas-Mitglied nicht verteidigt", sagt er, wenn man ihn zweifeln hören
möchte. Demnächst, sagt Cohen, werde er für mutmaßliche Terroristen vor
Gericht gehen, die den September-Attentätern geholfen haben sollen.
Welche, darüber müsse er schweigen. CNN hat ihn eben noch gefragt, ob er
auch bin Laden verteidigen würde: "Sure!" Als Jude sei er geradezu
verpflichtet, anderen zu helfen, die ebenfalls unterdrückt werden: "Wir
Juden wissen, wie es ist, verfolgt zu werden. Wir haben nicht das Monopol
aufs Leiden." Der Angriff auf Amerika, meint Cohen, sei auch die Folge
der amerikanischen Israel-Politik. "Die USA haben so viel Hass gesät,
es musste eines Tages einfach zu so etwas kommen".
"BIN LADEN IST WIE HITLER. DER HAT AUCH DIE GANZE WELT VERRÜCKT
GEMACHT"
Dass Paul Auster Jude ist, weiß kaum einer seiner
Leser. Sagt er. Ich frage, ob ihm das Jüdischsein egal sei, und er fragt
zurück: "Wie kann einem Juden das Judesein egal sein?" Bin Ladens Angriff
sei "der schrecklichste Moment für Juden in der amerikanischen
Geschichte".
 |
|
Zusammen mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt und ihrer 14-jährinen Tochter Sophie leben die Austers in Park
Slope, Brooklyns feinerer Gegend. Eigentlich wollte mich Paul Auster gar
nicht treffen: Er habe doch schon alles gesagt. Man solle jetzt schweigen —oder sich dafür
einsetzen, dass Amerika nicht alles Geld in einem globalen Krieg gegen
Terrorismus verpulvere. Paul Auster verabscheut Bush. Er habe kein
Vertrauen in dessen Regierung, die nur aus "kalten Kriegern" aus der
Regierung des Vaters bestünden.
Als ich an einem Nachmittag dann doch im Wohnzimmer der
Austers sitze, bessern drei bullige Handwerker die morsche Holzveranda
aus. Der Staub der Zwillingstürme habe sich in das Holz gefressen,
sagt Paul Auster, zieht an einem Zigarillo und fragt, ob ich nicht ein
Glas Whisky möchte. |
Er könne einfach nicht mehr über den 11. September reden,
entschuldigt er sich. Er findet die von den Handwerkern verursachte Unruhe
"spannend". Das Chaos erinnere ihn an jenen Dienstag im September. "Ich
dachte, ich würde nie wieder auch nur ein Wort schreiben." Wochenlang
habe er "nur sinnloses Zeug" getan, Rechnungen geschrieben, Müll
rausgetragen, neues Farbband für die Schreibmaschine gekauft. Drei Wochen
vor dem Angriff hatte er seinen letzten Roman beendet, der im Herbst
erscheint.
Die Anschläge, sagt er, "habe ich kommen sehen.
Natürlich nicht in dieser Dimension". Paul Auster plädiert für Demut und
dafür, sich für Gegenwelten zu interessieren. Am Abend zuvor habe er mir
seiner Frau den "tollsten Film der Welt" gesehen,
Sullivan's Travels.
Ein Film über einen plötzlich erfolglosen
Hollywoodproduzenten, der das wahre Leben als Obdachloser kennen lernen
will, um "wahre" Filme drehen zu können. Die Parabel gefällt Paul Auster: "Wir bombardieren die arabische Welt, dabei wissen wir gar nichts von
denen." Anstatt die fremde Welt kennen zu lernen, habe sich Amerika mit
Monica Lewinskv und Zigarren beschäftigt.
|
Das Badezimmer von Lisa Schwarz ist komplett rosa. Die
Kacheln, der Toilettenbezug, die Handtücher, die Kleenextücher. "Rosa
schmeichelt - den Falten", sagt Frau Schwarz mit ihrer tiefen Raucherstimme
und zündet sich eine Zigarette an. Die Achtzigjährige arbeitet als
Assistentin des Herausgebers an drei Tagen in der Woche im Büro der
deutsch-jüdischen Zeitung Aufbau. Am Morgen des 11.September kam Lisa
Schwarz aus dem Badezimmer und lief in ihre Fernsehecke in der Küche, wo
sie den Tag mit den NBC-Nachrichten beginnt. Die Bilder von den brennenden
Türmen konnte sie zunächst nicht einordnen: "Ich dachte, ich hätte aus
Versehen den Spielfilmkanal gedrückt." In den darauf folgenden drei Tagen
hat Lisa Schwarz zum ersten Mal das Kettenrauchen fast vergessen: "Ich hatte solche Angst
wie seit dem Holocaust nicht mehr." |
 |
Manchmal weint Lisa Schwarz, wenn im
Fernsehen wieder ein Bericht über die Anschläge läuft: "Aber das muss nichts heißen: Ich heule ja schon, wenn
mir jemand Happv Holidays wünscht". Den Nazis ist Schwarz in letzter
Minute entkommen und von aus Berlin in die Schweiz geflüchtet. Von dort
fuhr sie 1948 weiter nach New York. Sie lebt seit über fünfzig Jahren in
derselben Wohnung in der Upper West Side; in den Regalen stehen deutsche Bücher,
im Kühlschrank liegt deutsche Salami und im Wohnzimmer hängen der Duft von
Fendi und eine Weltkarte, auf der sie mit Bleistift Datum. Uhrzeit und Ort
von Kapitulationen der deutschen Armee mir Bleistift notiert hat. Das Fendi-Parfum versprüht sie jeden Tag, um den Rauch zu neutralisieren. Am
nächsten Tag treffen wir uns zum Mittagessen in einem Schweizer
Restaurant, Frau Schwarz liebt das Essen und das Land so sehr, dass sie
ihre Büronische mit Plakaten des Schweizer Fremdenverkehrsamtes tapeziert
hat. Sie sagt, die Angriffe hätten alle ihre jüdischen Freundinnen "aus
dem Gleichgewicht geworfen". Der Angriff habe "auch uns Juden gegolten".
Während sie mit ihren Rösti beschäftigt ist, hält sie inne, als sei sie
wie von einem Geistesblitz getroffen, und sagt: "Bin Laden ist wie Hitler.
Der hat auch die ganze Welt verrückt gemacht". Sie schminkt ihre
Lippen nach und lächelt über den Taschenspiegel hinweg: "Sie könnten auch
ein Muslim sein und trotzdem würde ich mit Ihnen zum Lunch gehen".
Claude Sabbah sitzt in seiner Boutique in Downtown
Manhattan, Da House of Sabbah, und er strahlt beim Thema 11.September,
dass man den goldenen Schneidezahn blitzen sieht: "Wir mussen jetzt alle
zusammenhalten", sagt der gebürtige Marokkaner, "Juden, Muslime, Christen,
Hinduisten." Vor fünf Jahren ist Sabbah aus Paris nach New York gezogen,
seitdem stattet er Lauren Hill und Miss Elliott aus, zieren seine Hosen,
Mäntel, Blusen und Abendroben Vogue-Cover und
füllen halbe Reportageseiten der New York Times. New York sei
das "Mekka der Juden".
Nachdem Sabbah 1997 in New York gelandet war, musste er
seine Koffer öffnen. Als der Zollbeamte Sabbahs Chanukka-Kerzenleuchter
und Gebetsriemen herausfischte, fragte er:
"Are vou Jewish?"
"Are vou praying?" "Yes."
"Weleome to New York!"
Er habe das Gefühl gehabt. "ich lande in der Bibel". In
Paris habe man ihn dirty Arab" geschimpft. in Casablanca "dirty Jew".
Und in New York "bin ich einfach Claude".
Der Jude Claude: Es ist Freitagmittag und plötzlich öffnet sich die Tür
zu seiner Boutique und zwei junge orthodoxe Juden aus Brooklyn bitten um
Aufmerksamkeit. Sie kommen unregelmäßig freitags, um mit Claude zu beten.
Unbeeindruckt von dessen Tattoos und Ringen und Ketten schnallen sie ihm
Gebetsriemen um, legen ihm eine Kippa auf die Baseballmütze — dann beten sie zu
dritt. Bevor sie gehen, belehren uns die zwei orthodoxen Jungs aus
Brooklyn, dass der 11.September ein Tag der "Erlösung" gewesen sei: "Wenn
so wenige Menschen es schaffen, die ganze Welt zu verändern, dann lernen
wir daraus: Jeder kann die Welt verändern. Wir müssen gute Taten
vollbringen."
Am Tag meiner Abreise rufe ich Jonathan, meinen
Sitznachbarn auf dem Flug nach New York, bei seinen Freunden an. Sie holen
ihn aus dem Bett. Er jobbt seit ein paar Tagen in einer Bar und hat ein
Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Aussicht. Gestern Nacht habe er an der
Bar ein sehr hübsches Mädchen kennen gelernt. "Erst war ich mir sicher,
sie ist lsraelin. Aber sie kommt aus Beirut!" Sie wollen heute vielleicht
ins Kino gehen.
Ansichten aus Israel:
Abraham zwischen den Welten
 
[Buch
/
CD]
|